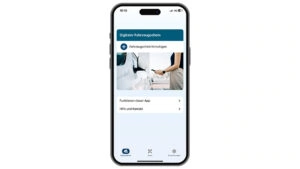Wie weit plant man mittlerweile IT/Storage-Strukturen voraus? Früher war nach drei Jahren alles abgeschrieben, heute geht’s eher in Richtung fünf Jahre. Geht sich das aus oder veralten die Systeme nicht schneller? Ist Software-defined die Lösung?
Antwort Doc Storage:
Software-defined Storage (SDS) ist eine Speicherarchitektur, die Speicher-Software von der Hardware trennt, auf der der Dienst betrieben wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen NAS- (Network Attached Storage) oder SAN-Systemen (Storage Area Network) ist SDS weitestgehend für die Leistung eines Industriestandard- oder x86-Systems konzipiert, wodurch die Abhängigkeit der Software von proprietärer Hardware entfällt, also den herstellerspezifischen Arrays.
Durch die Entkopplung der Speicher-Software und -Hardware lässt sich die Speicherkapazität nach Belieben und zu jedem Zeitpunkt erweitern. IT-Manager müssen sich nicht um den Einbau weiterer proprietärer Hardware bemühen, also weiterer Prozessoren oder Speichermoduln. Daneben lässt sich die Hardware jederzeit aufrüsten oder verkleinern. Hiermit gewährt SDS eine enorme Flexibilität.
Angenommen man verfügt über eine Reihe verschiedener x86-Server: Jeder hat eine andere Speicherkapazität und jeder benötigt eine andere Art von Speicher-Software, um zu funktionieren. Mit SDS lässt sich die Speicherkapazität von den unflexiblen Hardware-Komponenten lösen und an einem Ort zusammenfassen, der hierdurch beliebig flexibel und skalierbar wird. Mit SDS lässt sich die Speicherkapazität nahezu sofort erweitern, was dieses Konzept kostengünstig, flexibel und skalierbar macht. SDS ist heute Teil eines größeren Ökosystems namens hyperkonvergente Infrastruktur (frei definiert als »Software-defined Everything«), in dem alle Anwendungen von der gesamten Hardware getrennt sind. Der größte Vorteil dieses Ökosystems ist, dass eine absolute Freiheit besteht, welche Hardware angeschafft und wie viel Speicher wirklich benötigt wird.
SDS gegen proprietärer Hardware
Dabei bietet SDS eine Automatisierung durch ein simples Management, Standardschnittstellen (APIs) für die Verwaltung und Wartung von Speichergeräten und -diensten, virtualisierte Datenpfade mit Block-, Datei- und Objektschnittstellen, und Skalierbarkeit, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, Transparenz in der Nutzung und Überwachung. Heute altmodische, also traditionelle Speicherung ist meist monolithisch. Sie wurde als Paket aus proprietärer Hard- und Software verkauft. Der Nutzen von SDS liegt jedoch in seiner Unabhängigkeit von spezifischer Hardware. SDS trennt den Speicher selbst nicht von der Hardware. Es ist vielmehr lediglich eine Schicht, die viele Dienste mithilfe branchenüblicher Rechner anstelle proprietärer Hardware bereitstellt.
Grundsätzlich abstrahiert SDS die Steuerung der Speicheranforderungen, und nicht die tatsächliche Speicherung. Wie erwähnt handelt sich es sich um eine Software-Schicht zwischen physischem Speicher und der Datenanforderung, mit der sich steuern lässt, wie und wo Daten gespeichert werden. Die hierzu notwendige Controller-Software bietet Speicherzugriffsdienste, Netzwerk und Anbindungsmöglichkeiten. Das wichtigste Merkmal der Controller-Software besteht darin, dass sie keine Annahmen über die Kapazität oder Nutzung der zugrunde liegenden Hardware macht.
Es besteht die freie Wahl bei der Hardware, auf der Speicherdienste ausgeführt werden sollen. Die genutzte SDS-Anwendung muss nicht vom selben Hersteller stammen, welcher die Hardware verkauft hat. Jeder Standard- oder x86-Server lässt sich verwenden, um eine SDS-basierte Speicherinfrastruktur aufzubauen. Dies maximiert die Kapazität der vorhandenen Hardware, wenn der Speicherbedarf wächst.
Software-defined trennt Compute und Storage
SDS nutzt »scale out« statt »scale up«, so dass sich Kapazität und Leistung unabhängig voneinander anpassen lassen. Gleichzeitig ist es möglich, mehrere Datenquellen zu verbinden, um eine Speicherinfrastruktur aufzubauen. Objektplattformen, externe Festplattensysteme, Festplatten- oder Flash-Ressourcen, virtuelle Server und cloudbasierte Ressourcen (sogar für Workloads bestimmte Daten) können vernetzt werden, um ein einheitliches Speichervolumen zu erstellen.
SDS passt sich automatisch an Kapazitätsanforderungen an. Da SDS nicht auf eine bestimmte Hardware angewiesen ist, erfolgt die Automatisierung in einer unabhängigen Schicht. Somit lassen sich aus jedem Speicher, mit dem der Rechner verbunden ist, Daten abrufen. Das Speichersystem kann sich ohne externen Eingriff neue Verbindungen schaffen oder neue Hardware an die Daten- oder Leistungsanforderungen anpassen.
Herkömmliche Speichernetzwerke sind auf die Anzahl der Knoten, also Geräte mit zugewiesenen Netzwerkadressen, beschränkt, die zur Verwendung bereitstehen. SDS ist per Definition nicht auf diese Weise eingeschränkt. Hiermit ist es – theoretisch – unbegrenzt skalierbar.
SDS plant einen möglichen Ausfall mit ein
SDS kann auf allen branchenüblichen Rechnern und Festplatten ausgeführt werden, und hier liegt der Vorteil. Im Gegensatz zu anderen Speichertypen ist SDS ausschließlich von seiner eigenen Software abhängig. SDS geht davon aus, dass die darunter liegende Hardware, unabhängig von deren Kosten oder deren Alter, irgendwann ausfällt, und plant diesen Ausfall daher durch die Verteilung der Arbeitslasten über die Infrastruktur schon präemptiv ein. Dies bedeutet auch, dass SDS sowohl physisch auf dem Server direkt als auch in einer virtuellen Maschine (VM), beispielsweise unter Hyper-V oder VMware, laufen kann. Einige SDS-Produkte können auch über diese Container hinweg ausgeführt werden, so dass Benutzer Anwendungen und Speicherdienste über eine einzige Schnittstelle verwalten. Und dies unabhängig von der Infrastruktur, in der sich der Container befindet (physisch, virtuell oder in einer Cloud).
Sowohl bei SDS als auch bei der Speicher-Virtualisierung geht es um die Abstrahierung von Diensten auf einer beliebigen Hardware, die Konzepte sind allerdings nicht dieselben. Durch die Speicher-Virtualisierung kann die Kapazität vieler Speichergeräte gebündelt werden, hiermit sieht es dann so aus, als befände sich der gesamte Speicher auf einem Gerät. Im Gegensatz dazu abstrahiert SDS die Speicherdienste oder die Speicher-Software und trennt sie vom Gerät selbst.
SDS ist keine Cloud und kein NAS
Clouds sind Pools virtueller Ressourcen, auf die man bei Bedarf meist über Self-Service-Portale zugreift, unterstützt durch Verwaltungs- und Automatisierungs-Software. SDS hat viele dieser Eigenschaften gemeinsam, daher ist es leicht zu glauben, dass SDS einer Cloud gleichkommt. Allerdings ist SDS ist lediglich eine Schicht, die eventuell dabei hilft, Daten in eine Cloud einzuspielen und innerhalb einer Cloud-Umgebung einen einheitlichen Speicher bereitzustellen. Allerdings verfügt SDS über Cloud-Speicherfunktionen wie Netzwerkzugriff oder Verwaltungs- und Automatisierungs-Software, die eine schnelle Skalierung und Bereitstellung von gebührenpflichtigen Diensten ermöglicht. Funktionen, die SDS fast in die gleiche Familie wie Cloud-Speicher einordnen.
SDS ist kein NAS. Es ist nicht so, dass SDS nicht an ein Netzwerk angeschlossen wäre. Es erfordert immer eine Art Netzwerkverbindung, genau wie jedes andere Unternehmensspeichersystem. Es ist nur so, dass NAS die Dateien organisiert und teilt, während SDS das Speichervolumen selbst steuert. NAS kann auf einer SDS-Schicht bereitgestellt werden, aber SDS trennt die physischen Speichervolumen der Hardware vom Steuerungssystem.
Gruß
Doc Storage
Weiterführende Links: