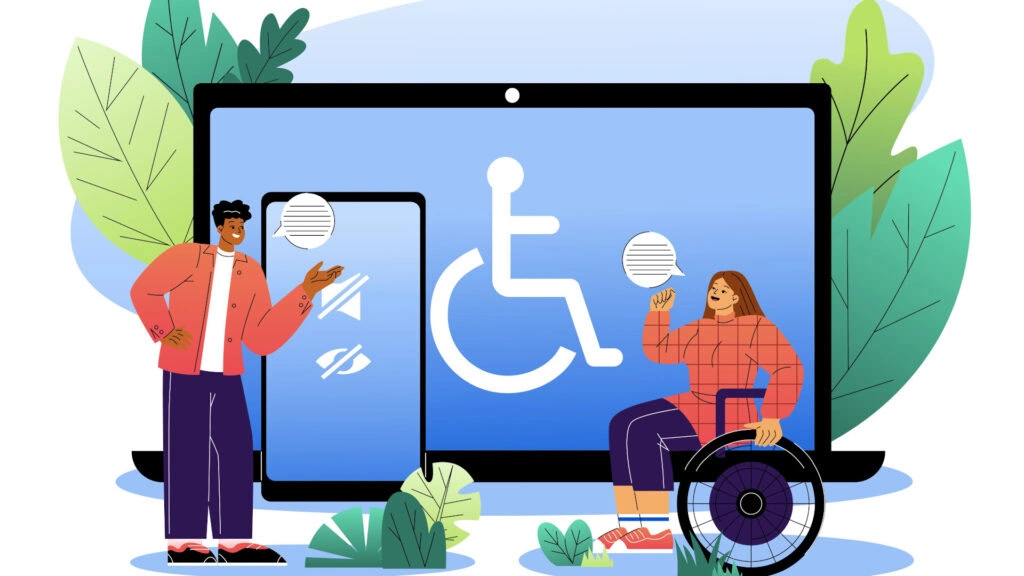Am 28. Juni 2025 tritt der European Accessibility Act (EAA) in Kraft. Das EU-Gesetz verpflichtet Unternehmen, digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten – von Webseiten über Apps bis hin zu E-Books und Self-Service-Terminals.
Trotz klarer Vorgaben und möglicher Sanktionen sind viele Unternehmen nach wie vor unzureichend vorbereitet. Dabei geht es längst nicht mehr nur um gesetzliche Anforderungen, sondern um eine zentrale Zukunftsfrage digitaler Geschäftsmodelle.
Fehlende Priorisierung: Warum Unternehmen noch nicht bereit sind
In vielen Organisationen ist digitale Barrierefreiheit weder strategisch verankert noch operativ durchdacht. Sie gilt als lästige Zusatzaufgabe, die erst spät im Projektverlauf berücksichtigt wird – wenn überhaupt. Dieses reaktive Vorgehen ist nicht nur kostenintensiv, sondern auch technisch aufwändig. Unternehmen, die Barrierefreiheit nicht frühzeitig mitdenken, werden gezwungen, bestehende Systeme mühsam nachträglich anzupassen. Das führt zu erhöhtem Aufwand, hohen Kosten und im schlimmsten Fall zu vermeidbaren Fehlentwicklungen.
Ein zentrales Problem: Barrierefreiheit wird häufig als rein technisches Thema der IT-Abteilung verstanden. Dabei betrifft sie die gesamte Organisation – von der Konzeption über das Design bis hin zur Content-Pflege. Nur wenn alle relevanten Abteilungen einbezogen werden, lässt sich eine durchgängig barrierefreie Nutzererfahrung sicherstellen.
Zudem fehlt es häufig an klaren Verantwortlichkeiten und strukturierten Prozessen. Viele Teams verfügen weder über das nötige Know-how noch über entsprechende Ressourcen. Besonders Unternehmen ohne bisherige Berührungspunkte mit Barrierefreiheitsstandards wissen oft nicht, wo sie ansetzen sollen. Schulungen, externe Beratung oder Pilotprojekte werden selten eingeplant – was die Umsetzung zusätzlich erschwert.
Technische Hürden und organisatorische Herausforderungen
Barrierefreiheit umfasst zahlreiche Anforderungen, die sich nicht ohne weiteres in bestehende Systeme integrieren lassen. Die technischen Anforderungen wie semantisches HTML oder Tastaturbedienbarkeit müssen von Anfang an berücksichtigt werden, damit sie nicht durch Unachtsamkeit unnötig kompliziert oder aufwendig werden. Auch die Verwendung von ARIA Attributen ist nicht immer einfach und kann zu neuen Problemen führen.
Besonders herausfordernd ist die konsistente Umsetzung über unterschiedliche Plattformen und Geräte hinweg. Unterschiede in Betriebssystemen, Browsern und Software-Versionen machen eine einheitliche barrierefreie Nutzererfahrung komplex und Drittanbieter-Tools sowie Plugins, die nicht barrierefrei optimiert sind, verschärfen das Problem zusätzlich. Unternehmen sind daher gefordert, ihre gesamte Tool-Landschaft kritisch zu prüfen.
Eine weitere zentrale Herausforderung besteht darin, Barrierefreiheit bereits im Entwicklungsprozess zu berücksichtigen. Unternehmen neigen häufig dazu, bestehende digitale Angebote nachträglich anzupassen, anstatt Barrierefreiheit von Anfang an mitzudenken. Barrierefreiheit darf jedoch nicht als Add-on verstanden werden, das sich im Nachhinein einfach dazuschalten lässt. Sie ist ein ganzheitlicher Qualitätsanspruch, der tief in bestehende Prozesse, Technologien und Inhalte eingreift. Deshalb ist es essenziell, Barrierefreiheit als integralen Bestandteil der digitalen Strategie zu verankern.
Digitale Barrierefreiheit als Wettbewerbsvorteil
Wer digitale Inklusion konsequent umsetzt, verschafft sich spürbare Vorteile im Wettbewerb:
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit: Klare Navigation, gut lesbare Inhalte und intuitive Bedienung verbessern die User Experience und bieten eine hohe Usability für alle Nutzer:innen.
- Erweiterte Zielgruppen: Allein in der EU leben rund 87 Millionen Menschen mit einer Form von Behinderung – dazu kommen ältere Nutzer:innen, temporär eingeschränkte Personen oder Menschen mit geringen digitalen Kompetenzen. Eine barrierefreie Gestaltung erschließt neue Kundengruppen und reduziert Absprungraten.
- Bessere Sichtbarkeit: Barrierefreie Seiten sind suchmaschinenfreundlich, da sie auf sauberen Code, klare Strukturen und valide Inhalte setzen. Das wirkt sich positiv auf das Ranking aus.
- Positives Markenimage: In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Sensibilisierung wird digitale Inklusion zu einem Reputationsfaktor. Unternehmen, die Barrierefreiheit ernst nehmen, positionieren sich als verantwortungsvoll und zukunftsorientiert und ein inklusiver Ansatz stärkt die Glaubwürdigkeit einer Marke.
Technologische Lösungen zur Unterstützung
Eine zukunftssichere Umsetzung gelingt, wenn Accessibility von Anfang an Teil der Digitalstrategie ist. Moderne CMS-Lösungen wie Storyblok ermöglichen flexible Strukturen, mit denen Entwickler:innen wiederverwendbare, barrierefreie Komponenten erstellen können. Diese Modularität spart langfristig Zeit und minimiert Fehlerquellen.
Daneben liefern automatisierte Tests – etwa mit Tools wie axe, Wave oder Lighthouse – wertvolle Erkenntnisse, da sie viele gängige Fehler erkennen. Sie allein reichen jedoch nicht aus, um Webseiten barrierefrei zu gestalten: Die manuelle Prüfung durch echte Nutzer:innen ist essenziell, um realitätsnahe Nutzungsszenarien zu erfassen. Insbesondere Screenreader-Kompatibilität, Kontraste und Tastaturnavigation sollten regelmäßig getestet werden, um Barrierefreiheit umfassend zu gewährleisten.
Fünf Schritte zur erfolgreichen Umsetzung
- Barrierefreiheit ins Design integrieren: Accessibility beginnt im Konzept, daher sollte sie bereits in der Konzeptionsphase fest verankert sein. Inklusives Design umfasst von Beginn an Farbkontraste, Typografie, klare Navigationsstrukturen und mobile Nutzung.
- Mitarbeitende schulen und sensibilisieren: Barrierefreiheit ist eine Aufgabe, die alle Unternehmensbereiche betrifft. Schulungen für Entwickler:innen, Content-Verantwortliche und Designer:innen schaffen ein gemeinsames Verständnis, vermitteln notwendiges Wissen und fördern bereichsübergreifende Zusammenarbeit.
- Technologische Unterstützung nutzen: CMS-Systeme mit integrierten Accessibility-Checks sowie automatisierte Test-Tools unterstützen den laufenden Entwicklungsprozess.
- Monitoring und Qualitätssicherung etablieren: Die Umsetzung von Barrierefreiheit ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Regelmäßige Audits und Feedbackschleifen mit betroffenen Nutzer:innen decken Schwächen auf und sichern kontinuierliche Verbesserung.
- Von Best Practices aus der Praxis lernen: Erfolgreiche Umsetzungen aus verschiedenen Branchen zeigen, dass eine proaktive Herangehensweise langfristige Vorteile bietet. Unternehmen wie Claro oder Wüsthof belegen: Wer frühzeitig investiert, profitiert von besserer Nutzerbindung und positiver Markenwahrnehmung.
Fazit: Barrierefreiheit als Investition in digitale Zukunftsfähigkeit
Der European Accessibility Act markiert einen Wendepunkt: Barrierefreiheit wird zur Pflicht – rechtlich, technisch und strategisch. In Zukunft wird digitale Inklusion nur noch stärker in den Fokus rücken, denn die gesellschaftlichen Erwartungen nehmen kontinuierlich zu. Unternehmen sind demnach gefordert, nachhaltige Strategien zu entwickeln. Durch frühzeitiges Handeln sichern sich Organisationen nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern schöpfen Marktpotenziale voll aus. Damit stellt Barrierefreiheit einen wichtigen Baustein der digitalen Transformation dar und bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich als zukunftsorientierte Marke zu positionieren.
Schließlich ist digitale Inklusion kein kurzfristiger Trend, sondern eine nachhaltige Investition in gesellschaftliche Verantwortung, Qualität und Markenwert. Wer sie ernst nimmt, stärkt das eigene digitale Ökosystem und schafft echte Zugänglichkeit für alle.