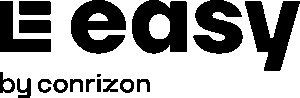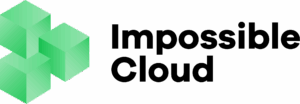Spätestens seit sich ChatGPT vom Hype zum Mainstream entwickelt hat, wird das Thema künstliche Intelligenz kontrovers diskutiert – nicht nur in Bezug auf Datenschutz und Urheberrecht, sondern vor allem im Zusammenhang mit Arbeitsplatzverlusten und Haushaltslöchern. Kann eine Sondersteuer hier helfen?
„Wenn du erwachsen bist, hast du vielleicht keinen Job“, orakelte der Historiker Yuval Noah Harari bereits 2018 in seinem Bestseller 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Nicht einmal ein Jahrzehnt später, scheint es, sollte sich seine Prophezeiung bewahrheiten. Wie die Ergebnisse des Berichts KI am Arbeitsplatz zeigen, nutzt nicht nur bereits ein signifikanter Anteil (71 Prozent) von Arbeitnehmenden künstliche Intelligenz im Job, 25 Prozent der Befragten gaben auch an, aufgrund von KI ihren Arbeitsplatz verloren zu haben. Eine Entwicklung, die auch der Staat kritisch beobachtet. Schließlich würde ein massiver Rückgang von Lohnsteuerzahlungen ein Millionen- oder sogar Milliarden-Loch in den öffentlichen Bundeshaushalt reißen. Um potenziellen Krisen zuvorzukommen, kam aus den Reihen der linken Parteien ein derzeit kontrovers diskutierter Vorschlag: eine Sondersteuer auf künstliche Intelligenz. Doch wie sinnvoll ist ein solches Vorhaben?
(Intelligente) Maschinen als Steuerzahler
Bahnbrechend neu ist die Idee einer KI-Steuer nicht. Im Gegenteil: Wann immer technischer Fortschritt Arbeitsplätze und damit potenzielle Einnahmen des Staates gefährdet, flammt, etwa seit den 1960er-Jahren, also mit der ersten Welle der Automatisierung, die Debatte über Abgaben auf (clevere) Maschinen wieder auf. Angesichts der zunehmenden Verbreitung digitaler Technologien schlug 2017 etwa auch Bill Gates vor, dass Unternehmen, die Roboter nutzen, um dieselbe Arbeit zu verrichten, die sonst ein Mensch erledigt, eine Steuer zahlen. Schließlich würden durch diese Art der Automatisierung vor allem standardisierte Arbeitsplätze wegfallen.
Mit dem Aufkommen der generativen KI sind laut IWF auch kognitive, hoch qualifizierte Tätigkeiten gefährdet. Laut Berechnungen der Experten haben die neuen Technologien das Potenzial, 60 Prozent der Jobs in hoch entwickelten Ländern zu ergänzen oder komplett zu übernehmen. Bei etwa einer Hälfte der Betroffenen dürfte der KI-Einsatz mit höherer Produktivität oder gesteigerter Effizienz zu Buche schlagen. Bei anderen – beispielsweise den Mathematikern, den Programmieren oder den Buchhaltern – sieht es nicht ganz so rosig aus.
KI-Steuer gegen soziale Ungleichheit
Ein viel diskutiertes Instrument, um die negativen Folgen von technischem Fortschritt für Arbeitsmarkt, Sozialsysteme und den Bundeshaushalt abzufedern, ist eine KI-Steuer. Zwar gibt es angesichts der schwierigen Haushaltsverhandlungen aktuell keine konkreten Pläne in der Ampelkoalition, der Co-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff, bekräftigt gegenüber dem Handelsblatt allerdings: „Die Idee der KI-Steuer gleicht dem Konzept der Maschinensteuer.“ Um die Staatskasse vor Millionen- oder sogar Milliardenlöchern zu bewahren, könnte eine solche Abgabe dazu dienen, die durch künstliche Intelligenz erzielten Produktivitätsgewinne und wirtschaftlichen Vorteile gerecht auf die Gesellschaft zu verteilen. Unternehmen, die stark in intelligente Systeme investieren und dadurch hohe Gewinne erzielen, schaffen eine Ungleichheit im Vergleich zu traditionellen Arbeitskräften, die tendenziell benachteiligt werden. Eine Steuer, so das Argument, hat das Potenzial, diese Disparität auszugleichen und wettbewerbsfähige Bedingungen zu schaffen. Davon könnte auch der Staat profitieren – insbesondere, wenn die Einnahmen zur Finanzierung öffentlicher Dienste und der Instandhaltung der Infrastruktur verwendet werden.
Mehr Bürokratie für die KI
Ganz so einfach, wie das klingt, ist die Erhebung einer neuen Steuer in der Praxis allerdings nicht. Zwar existieren in puncto Rechtsrahmen seit Mai 2024 in der Europäischen Union einheitliche Regeln, im AI Act bleiben jedoch wesentliche Fragen unbeantwortet. Als weltweit erstes Gesetz zum Umgang mit künstlicher Intelligenz klassifiziert die EU-Verordnung entsprechende Technologien in vier Risikogruppen: inakzeptables, hohes, begrenztes und minimales bzw. kein Risiko. Technologien, die etwa dem Social Scoring oder der biometrischen Identifizierung dienen, gehören in die erste Kategorie und gelten damit grundsätzlich als verboten. Hochrisikosysteme, beispielsweise in der zivilen Luftfahrt oder in Bereichen der kritischen Infrastruktur, unterliegen wiederum einer strengen Überwachung und Kontrolle.
In die dritte Kategorie fallen generative Modelle. Dazu gehören beispielsweise Chatbots oder LLMs zur Erstellung von Text-, Audio-, Bild- oder Video-Dateien. Sie durchlaufen ebenfalls eine gründliche Prüfung und unterliegen neben Transparenzanforderungen bezüglich der verwendeten Daten auch einer allgemeinen Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte. Für Tools, die gemäß KI-Verordnung kein oder lediglich ein minimales Risiko darstellen, etwa in Videospielen oder Spam-Filtern, sieht das Regelwerk keine Kontrollmechanismen vor. Die Verordnung spricht lediglich von freiwilligen Verhaltenskodizes. Was der AI Act nicht eindeutig vorgibt, ist eine belastbare Definition von künstlicher Intelligenz, die sich auch auf steuerliche Fragen anwenden lässt. Im Gesetz ist KI nur „ein maschinengestütztes System, das für einen in unterschiedlichem Grad autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann“ (Gesetz über künstliche Intelligenz, Art. 3 Abs. 1, 2022). Neben hoch entwickelten, spezialisierten Systemen schließt das grundsätzlich auch andere weitverbreitete Technologien wie Foto-Filter und Saugroboter ein. Zur Umsetzung einer KI-Steuer bedarf es aber einer genauen Differenzierung.
Das beginnt mit der Frage: Welche Formen von künstlicher Intelligenz sollen unter welchen Bedingungen besteuert werden? Als mögliche Lösung dieses Dilemmas brachte der Vize-Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Andreas Audretsch, im Gespräch mit dem Handelsblatt vor, nur jene Großkonzerne besteuern zu wollen, die KI selbst vermehrt einsetzen oder verkaufen. Damit beträfen potenzielle KI-Abgaben zwar vorrangig Unternehmen, in einer zunehmend globalisierten Welt ergeben sich daraus aber neue Fragen. Steuerlich relevant dürfte dabei vor allem sein, ob der Unternehmenssitz oder das Land, in dem die Umsätze entstehen, maßgeblich sein soll.
Innovationskiller KI-Steuer
Nicht nur die schwammige Rechtslage sorgt in der KI-Steuerdebatte für Probleme. Kritische Stimmen meldeten sich vor allem aus der Wirtschaft. So bewertete beispielsweise der Handelsverband Deutschland eine solche Abgabe als falschen Ansatz. Es komme in der derzeitigen Entwicklungsphase vielmehr darauf an, den Einsatz künstlicher Intelligenz zu fördern und Unternehmen in ihrem Engagement zu unterstützen, heißt es in einer Meldung. Ähnlich kritisch fällt auch das Urteil des IWF aus. Als Industriestandort sei Deutschland darauf angewiesen, den technologischen Fortschritt zu unterstützen, um im internationalen Wettbewerb seine Führungsposition zu halten. Eine KI-Steuer würde eher Anreize für Investitionen nehmen und Innovationen ausbremsen. Dadurch verlöre der Wirtschaftsstandort insgesamt an Attraktivität, was laut Expertenmeinung des IWF Abwanderungen ins Ausland und Arbeitsplatzverluste nach sich zöge.
Mit anderen Maßnahmen gegensteuern
Egal wie die Diskussionen um die Besteuerung von (intelligenten) Maschinen ausgeht, in einem Punkt sind sich alle einig: In ihrer kurzen Geschichte hat die künstliche Intelligenz nicht nur riesige Fortschritte gemacht, sie hat auch das Potenzial entwickelt, etliche Branchen umzukrempeln. Trotzdem gilt der letzte Satz in Alan Turings Aufsatz Computing Machinery and Intelligence von 1950 noch immer:
„Wir können nicht weit in die Zukunft sehen, aber wir können sehen, dass noch viel zu tun ist.“ Entsprechend empfiehlt beispielsweise der IWF als Alternative zur KI-Steuer gezielte Fördermaßnahmen. Up- und Reskilling-Programme könnten Arbeitnehmer bereits jetzt fit für neue Tätigkeiten machen, die durch Automatisierung und künstliche Intelligenz entstehen und so nicht nur potenzielle Arbeitsplatzverluste abfedern, sondern auch die staatliche Liquidität sichern. Gleichzeitig geht der IWF davon aus, dass sich durch systematisches Vorantreiben der Digitalisierung neue Wirtschaftszweige eröffnen, die ihrerseits neue Berufe schaffen. Daher sollten Schulen und Universitäten schon jetzt flexible Bildungspläne entwickeln, um Absolventen besser auf die veränderten Bedingungen des Arbeitsmarkts vorzubereiten.
Eine weitere Option, um den Staatshaushalt krisensicher aufzustellen und Arbeitnehmer zu entlasten, bildet die Umverteilung von Steuerlasten. Hier plädieren die Wirtschaftsexperten für eine Senkung der Lohnsteuer sowie eine Anhebung der Besteuerung von Kapitalerträgen. Zusätzlich könnte die gezielte Förderung von Branchen mit hohem Arbeitskräftebedarf, wie Pflege und Betreuung, dazu beitragen, sowohl die drohende Massenarbeitslosigkeit als auch den Fachkräftemangel zu bekämpfen.