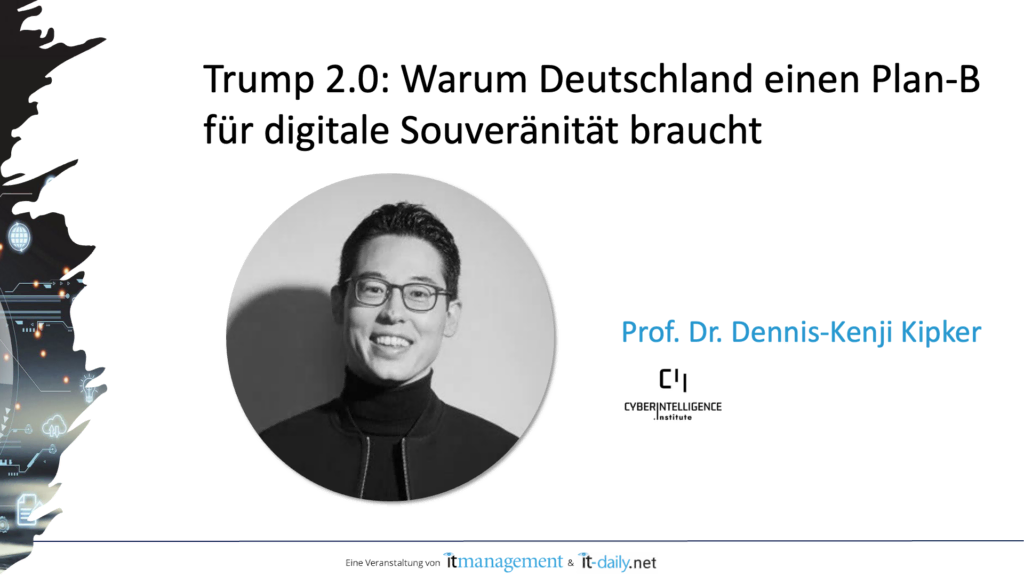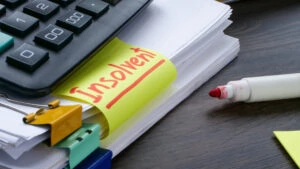Europa und Deutschland sind mangels ausreichender eigener digitaler Souveränität durch die Notwendigkeit der Datenübermittlung in die USA erpressbar geworden – und das gilt sowohl für Unternehmen wie auch für Behörden.
Indem ein neuer US-Präsident kraft seines Amtes von einem Tag auf den anderen das transatlantische Datenschutzabkommen aushebeln könnte, sehen wir uns jetzt vor der unaufschiebbaren Notwendigkeit, zeitnah einen Plan-B in Sachen Digitalsouveränität zu entwickeln. Das wurde zu lange aufgeschoben, und nun werden wir mit den seit Jahren erwartbaren Folgen ummittelbar konfrontiert. Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker klärt in diesem Vortrag darüber auf, was jetzt zu tun ist, um dieses zentrale Thema für Europa anzugehen!
Vortrag: Trump 2.0: Warum Deutschland einen Plan-B für digitale Souveränität braucht
Sprecher: Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker, cyberintelligence. institute
Nach der Anmeldung zum Newsletter erhalten Sie den Link zum Video (ca. 30 Minuten, deutsch).
Jetzt für den Newsletter 📩 anmelden und sofort herunterladen! 🔥
Zusammenfassung des Vortrags
Die zunehmende Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Diensten und IT-Infrastrukturen stellt Europa vor große Herausforderungen. Wie Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker in dem Vortrag erläuterte, benötigt insbesondere Deutschland dringend einen Plan B für die digitale Souveränität. Die politischen Entwicklungen in den USA verstärken den Handlungsdruck zusätzlich.
Von der Digitalisierung zur Cloudification
Der weltweite Cloud-Computing-Markt wächst rasant. Wie aktuelle Zahlen von Statista belegen, wird der Umsatz von 270 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf prognostizierte 824 Milliarden US-Dollar in 2025 steigen. Allein zwischen 2024 und 2025 rechnet man mit einem Zuwachs von fast 150 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung zeigt die stark wachsende Abhängigkeit von Cloud-Diensten.
Problematische Datenschutzabkommen
Die Geschichte der Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA ist von Rückschlägen geprägt. Nach den Snowden-Enthüllungen 2013 erklärte der Europäische Gerichtshof das Safe-Harbor-Abkommen 2015 für nichtig. Auch der Nachfolger „Privacy Shield“ wurde 2020 gekippt. Das aktuell geltende „EU-US Data Privacy Framework“ steht nun durch die politischen Veränderungen in den USA erneut auf dem Prüfstand.
Trump 2.0: Katalysator für Veränderung
Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten wirkt als Brandbeschleuniger für die bisher unzureichende europäische Digital-Souveränität. Seine „America First“-Politik und die angekündigte Überprüfung bisheriger wirtschaftspolitischer Entscheidungen könnten auch das aktuelle EU-US Data Privacy Framework gefährden.
Schrittweise Unabhängigkeit notwendig
„Es geht nicht darum, die Technologieabhängigkeit von anderen Staaten von einem Tag auf den anderen zu kippen, sondern ein gezieltes De-Risking zu betreiben“, erläutert Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker. Dies bedeute, sukzessive strukturell unabhängiger von drittstaatlichen Einflüssen zu werden. Der Prozess sollte bei kritischen Verwaltungsdienstleistungen beginnen und sich dann über Wirtschaftsbetriebe bis hin zu Verbraucherthemen erstrecken.
Lösungsansatz: Gezieltes De-Risking
Die Lösung liegt nicht in einer abrupten Abkopplung von US-Technologien, sondern in einem strategischen De-Risking-Ansatz:
- Identifikation kritischer Abhängigkeiten
- Priorisierung sensibler Bereiche (Verwaltung, kritische Infrastrukturen)
- Schrittweiser Aufbau souveräner Alternativen
- Entwicklung robuster europäischer IT-Infrastrukturen
Open Source als Teilbaustein
Open-Source-Technologien können einen wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität leisten, sind aber nicht die alleinige Lösung. Die Landeshauptstadt München hatte ihre IT mehrere Jahre komplett auf Open Source umgestellt, was Kosten sparte und eine Herstellerabhängigkeit vermied. Allerdings müssen auch andere Innovationsbereiche berücksichtigt werden.
Handlungsdruck steigt
Die Europäische Union hat mit der Datenschutz-Grundverordnung, der NIS2-Richtlinie und dem Cyber Resilience Act bereits wichtige Grundlagen geschaffen. Diese hohen Standards gilt es nun als Grundlage für den Aufbau einer eigenständigen digitalen Infrastruktur zu nutzen. Der politische Wandel in den USA sollte als Weckruf verstanden werden, die digitale Souveränität Europas weiter voranzutreiben.