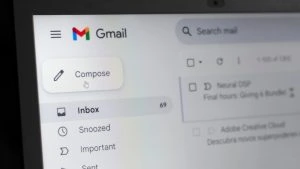Vor mehr als 130 Jahren begann der Siegeszug von jenen drei Worten, die auch heute noch für Qualität und Verlässlichkeit stehen: „Hergestellt in Deutschland“. Was für Waren und Maschinen gilt, kann für Software nicht verkehrt sein – oder?
Apple hat es vorgemacht: „Designed by Apple in California” prangt auf vielen Produkten, 2016 erschien sogar ein Fotobuch mit identischem Titel. Das findet insbesondere in den USA Anklang und ist gleichzeitig ein gutes Argument für höhere Preise. Auch deutsche Unternehmen werben mit ihrem Heimatland: der Elektrogeräte-Hersteller Brennenstuhl etwa setzt auf „Engineered in Germany“, das Medizintechnik-Unternehmen Stockert geht einen Schritt weiter und differenziert seine Produkte sogar mit dem Slogan „Designed, developed and made in Germany“.
Kein Wunder, denn nach wie vor gilt die Herstellung in Deutschland als Qualitätsmerkmal. Das bestätigt auch Statistas Made-in-Country-Index: In der weltweiten Erhebung wurden mehr als 40.000 Konsument:innen aus über 50 Ländern nach der Markenstärke von 49 Herkunftsländern sowie der Europäischen Union befragt. Das Ergebnis: Deutschland wird am positivsten gesehen und belegt im Ranking den ersten Platz.
Vorteile liegen auf der Hand
Im 19. Jahrhundert in Großbritannien eigentlich als Abgrenzung zu minderwertigen Produkten aus Deutschland eingeführt, wurde „Made in Germany“ schnell weltweit zu einem Garant für hohe Qualität. Daraus ergibt sich für die werbenden Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil, insbesondere im Ausland genießen Produkte aus Deutschland ein hohes Vertrauen und gelten als Premium-Produkt. Dazu gibt das Siegel rechtliche Sicherheit, denn die Qualitätsstandards in Deutschland sind so hoch wie in kaum einem anderen Land. Innerhalb der Bundesrepublik kommen die Aspekte Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung hinzu: Wer in Deutschland fertigt, unterstützt hiesige Arbeitsplätze und damit den Binnenmarkt.
Nur schwer übertragbar auf digitale Produkte
Hörgeräte, Schuhe, Ferngläser, Windkraftanlagen: Bislang steht hinter „Made in Germany” eigentlich immer ein physisches Produkt. Das spiegelt sich auch in den gesetzlichen Bestimmungen wieder, denn eine konkrete Norm, was als „Made in Germany“ bezeichnet werden darf, sucht man in Deutschland vergebens. Zwar hat sich der Bundesgerichtshof bereits mehrfach dem Thema angenommen, die Urteile sind aber Einzelfallentscheidungen. Konsens ist lediglich, dass „der für die wertbestimmenden Eigenschaften der Produkte maßgebliche Herstellungsvorgang“ in Deutschland stattgefunden haben muss.
Diese Definition lässt Raum zur Interpretation und kann nicht ohne Weiteres als Blaupause für Software herangezogen werden. Vorher müssen grundlegende Fragen geklärt werden:
- Muss die Entwicklungsarbeit vollständig in Deutschland stattfinden?
- Darf das internationale Team in der ausländischen Dependance noch mitwirken?
- Und kann eine SaaS-Lösung in der AWS-Infrastruktur betrieben werden oder ist auch das Hosting eine solche wertbestimmende Eigenschaft?
Initiativen wie „Software Made in Germany“ beziehungsweise „Software Hosted in Germany“ des Bundesverbands IT-Mittelstand e. V. bieten eine entsprechende Zertifizierung an und überprüfen, ob die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Rund 400 Unternehmen haben sich bereits den Regularien verpflichtet und dürfen mit dem gleichnamigen Siegel werben.
KI made in Germany: The next big thing?
KI-Anwendungen wird vielerorts noch mit Skepsis begegnet. So war der Aufschrei unter Datenschützer:innen groß, als Microsoft im März 2024 ankündigte, das auf OpenAI basierte Copilot in Microsoft 365 zu integrieren. Der Aufwand wird zwar nicht mit dem zur Einführung der DS-GVO vergleichbar sein, aber eine Datenschutzfolgenabschätzung wird in jedem Falle erforderlich sein. Kein Wunder also, dass große Firmen vermehrt dazu übergehen, selbst gehostete GPTs zu nutzen.
Vor allem junge Unternehmen, die mit ihrem Produkt spezifische Anwendungsfälle bedienen und eine Nische besetzen, sollten von Anfang an die Anforderungen deutscher Kund:innen im Auge behalten. Das auf Wissensmanagement spezialisierte KI-Start-up Tucan.ai etwa entwickelt nicht nur die Lösung in Deutschland, selbst die komplette Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik. Bei Bedarf wird die Software sogar on-premise installiert – und integriert sich damit nahtlos in die eigene Systemlandschaft.
Das überzeugt nicht nur Firmenkund:innen, sondern auch die öffentliche Verwaltung, die von Lösungen aus dem nichteuropäischen Ausland Abstand nehmen – aus besagten Datenschutzbedenken.
Innovationsmotor für die öffentliche Hand
Wenn man so will, trägt der Herstellungsnachweis dazu bei, dass Innovationen schneller ihren Weg in Bereiche finden, die grundsätzlicher, zurückhaltender und bedachter agieren als Wirtschaftsunternehmen. Denn wer hätte vor nicht einmal fünf Jahren noch gedacht, dass öffentliche Organisationen wie die Stadt Ingolstadt, der Landtag Mecklenburg-Vorpommern oder die Stadt Burgwedel ihren Mitarbeitenden eine KI-Software wie Tucan.ai an die Hand gibt, um Besprechungen oder Sitzungen automatisiert zu transkribieren und archivieren?
Ein weiteres gutes Beispiel ist die KI-Trainings-App Buddy Bo, die vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) entwickelt wurde, um Grundschüler:innen beim Erlernen ihrer Lesekompetenz zu unterstützen. Schleswig-Holstein treibt nicht nur aktiv die KI-Förderung im Schulbereich voran, sondern förderte die Entwicklung der App sogar mit 200.000 Euro. Aus den Nutzungsbedingungen geht hervor, dass das ISQH die „Datensicherheit des Grundverfahrens“ verantwortet. Sprich: Alle Daten bleiben im Inland und werden nur hier verarbeitet. Anders wären Politiker:innen, Lehrkräfte und Eltern gleichermaßen wohl auch nicht zu überzeugen gewesen, die App unseren Kleinsten an die Hand zu geben und ihnen Künstliche Intelligenz näherzubringen.